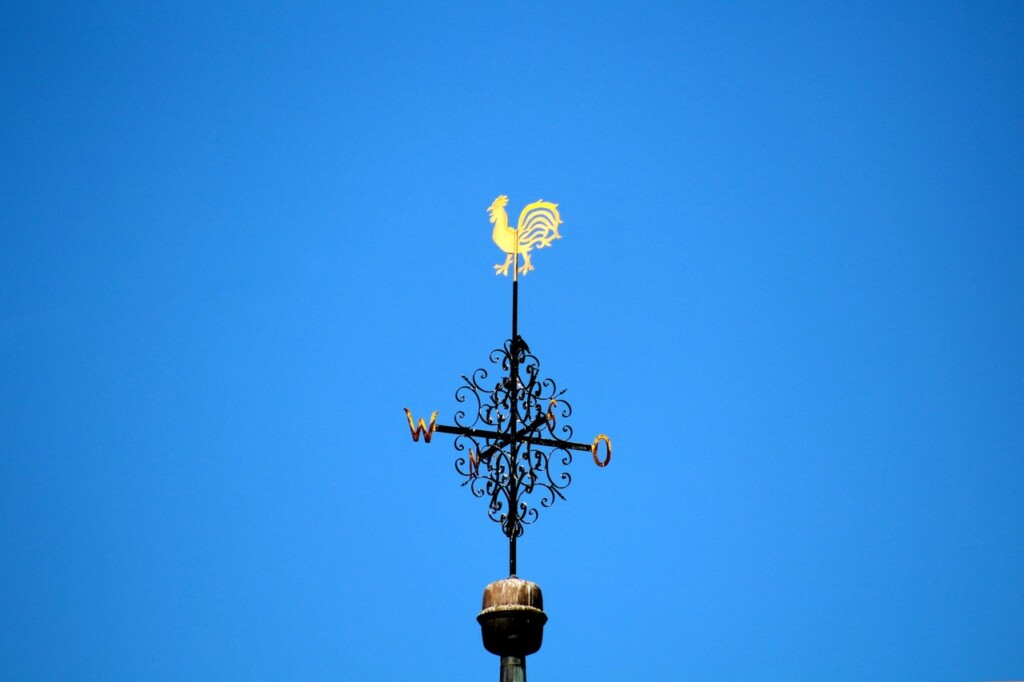Warum gibt es Wegekreuze?

Wegekreuze entstanden ursprünglich als Ausdruck christlichen Glaubens, aber auch aus sehr praktischen und sozialen Motiven. Schon im Mittelalter wurden sie an Straßen, Feldwegen und Kreuzungen errichtet, oft von Privatpersonen oder Dorfgemeinschaften. Ein Grund war das Bedürfnis, den Reisenden unterwegs eine Gelegenheit zum Innehalten und Beten zu geben — Wegekreuze dienten als sichtbare Zeichen des Glaubens, als Schutzsymbol und Mahnung zur Besinnung. Besonders an gefährlichen Stellen, wie steilen Pässen oder unfallträchtigen Kreuzungen, galten sie als Bitte um göttlichen Beistand oder Dank für überstandene Gefahren.
Zudem erfüllten sie soziale und kulturelle Funktionen: Wegekreuze markierten Grenzen, Treffpunkte oder sogar Gerichtsstätten. Nicht selten erinnern sie auch an konkrete Ereignisse wie einen Unfall, ein Gelöbnis oder einen Todesfall an Ort und Stelle. Sie wurden von Stiftern nicht nur aus Frömmigkeit, sondern auch, um für die eigene Seele oder die von Verstorbenen Fürbitten zu erbitten, aufgestellt.
Ihr Fortbestehen bis heute hat auch mit Tradition und regionaler Identität zu tun. Wegekreuze sind Teil der Landschaft geworden, Denkmale des Glaubens und Ausdruck einer Verbindung zwischen Mensch, Natur und Transzendenz. Sie prägen vielerorts noch immer das Bild ländlicher Wege, nicht zuletzt als kulturelles Erbe.